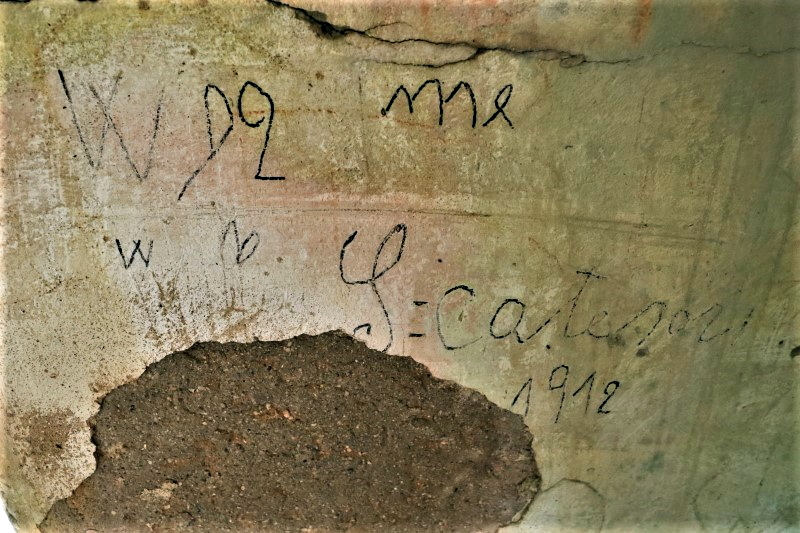1994 fand man dort versteinerte Säugetier-Fußabdrücke aus dem Pliozän (4 Mio. Jahre alt), eine große Seltenheit. Am Fuß des Felsens gefundene Muscheln und andere maritime Fossilien zeugen davon, dass dieser Teil der adriatischen Platte vor Millionen von Jahren in subtropischen Breiten lag.
Bereits in vorgeschichtlicher Zeit war der Felsen besiedelt, und schon in vorrömischer und erst recht in römischer Zeit stellte er eine wichtige strategische Position dar, weil in seiner Nähe wichtige Straßen und eine Furt durch den Tagliamento verliefen.
Die Besiedlung setzte sich nachweislich bis ins Mittelalter fort; eine Belagerung durch die Avaren im Jahr 610 ist sogar schriftlich festgehalten.
902 zerstörten die Ungarn die befestigte Siedlung; im Nachgang wurde eine Burg errichtet, von der es jedoch überwiegend schriftliche Erwähnungen gibt und weniger Funde.
Nach einer Belagerung im Jahr 1514 wurde das Castel Novo erbaut, das eine deutlich reduzierte Verteidigungsfunktion hatte und eher Wohnzwecken diente. Reste des Untergeschosses sind heute noch zu sehen.
Zu Zeiten Napoleons wurde die Festung von den Franzosen erobert und spielte eine Rolle in den Auseinandersetzungen zwischen Habsburg und Frankreich um die Vorherrschaft über das Friaul.
Im Rahmen des Risorgimentos (eine Bestrebung, die unabhängigen Fürstentümer und Regionen der Apenninen-Halbinsel zu einem Nationalstaat Italien zu vereinigen) gelang es den Friulanern im März 1848, die kaiserlichen Truppen aus der Festung zu vertreiben und sie für fast 7 Monate besetzt zu halten. Nachdem die Gegend an Italien gefallen war, wurden konstruktive Änderungen an der Festung durchgeführt, vor allem nachdem sie im Jahr 1900 in das Verteidigungssystem Alto Tagliamento – Val Fella integriert wurde.
Im ersten Weltkrieg war die Festung in keine Kampfhandlungen involviert und diente als Garnison; danach wurde sie erneut umgestaltet. Im zweiten Weltkrieg besetzten deutsche Truppen das Fort, was zahlreiche und intensive Bombardements durch die Alliierten nach sich zog, die zu vielen Zerstörungen führten.
Einen erneuten Schlag erfuhr die Festung durch das Erdbeben von 1976, das u.a. die Kirche San Pietro beschädigte.
Bereits zwischen den Weltkriegen, im Jahr 1923, war die Festung zum Nationaldenkmal erklärt worden, und 1951 wurde sie endgültig demilitarisiert.
Heute kann sie problemlos besichtigt werden; im Gegensatz zu anderen Festungsanlagen rund um Udine konnten wir bei unserem Besuch im Juni 2019 keine Einschränkungen wie z.B. verschlossene Räume oder Gebäude feststellen.
Leider gab es aber Einschränkungen anderer Art: Zum einen hielt uns die enorme Hitze davon ab, die von dichter Vegetation überwucherten Teile der Festung näher zu erkunden (vor allem den Nordteil), zum anderen verhinderte die Anwesenheit des italienischen Militärs, das offenbar in der Nähe der Panzerbatterie eine Übung durchführte, so manche interessante Aufnahme.
Der einzige Plan, der uns zur Orientierung zur Verfügung stand, ist dieser hier:
Im Großen und Ganzen genügte er, um sich zurecht zu finden, zumal viele Elemente des Forts gut beschildert sind. Einzelne darauf sichtbare Elemente wie z.B. die „Batterie Nr. 1“ konnten wir jedoch nicht entdecken.
Das erste, was man von der Forte di Osoppo sieht, wenn man der Via Divisione Julia folgt (der Weg zur Festung ist vom Ortskern aus gut ausgeschildert), ist das Eingangstor:
Ma kann mit dem Auto durchfahren bis zum Vorplatz der Kirche San Pietro und das Auto dort abstellen:
Am Nordostrand des Platzes fallen sofort umfangreiche Gebäuderuinen auf:
Es handelt sich um die Überreste des Offizierskasinos; die nachfolgende Aufnahme (Aufnahmedatum unbekannt) zeigt es in intaktem Zustand:
Die Aussicht vom östlichen Rand des Platzes ist atemberaubend. Ein interessantes Detail im Tal ist der Parco del Rivellino – man erkennt deutlich die Reste der Bastionen aus napoleonischer Zeit:
Ein weiteres Bauwerk auf dem Platz ist die „Casa del Tamburo“, dessen Ursprünge auf die Zeit zurückgehen, als das Friaul venezianisch war. Das Gebäude diente im Lauf der Zeit unterschiedlichen Zwecken, als Unterkunft des Kommandanten Mitte des 18 Jahrhunderts bis zur Nutzung als Magazin und Krankenstation im frühen 20. Jahrhundert. Heute beherbergt das Gebäude eine Bar:
Folgt man dem an der Westseite der Casa del Tamburo verlaufenden Weg nach Süden, passiert man die ehemaligen Unterkunftsgebäude (auf dem Foto rechts zu sehen):
Man gelangt schließlich zum Reduit aus venezianischer Zeit:
Am Ende des Reduits führt eine Treppe hinunter zur Panzerbatterie. Sie wurde 1909 – 1910 errichte und war mit 4 Geschützen 149/A unter drehbaren Panzerkuppeln ausgestattet. In der jüngeren Vergangenheit hat man das Batteriedach neu betoniert, dabei aber – im Gegensatz zu den meisten anderen Panzerbatterien – die Geschützbrunnen nicht verfüllt:
Hier ein Blick aus der Panzerbatterie nach außen in Richtung Reduit:
Der zentrale Korridor der Panzerbatterie; die Zugänge zu den Geschützbrunnen sind auf der linken Seite.
Einer der Geschützbrunnen:
Eine Riservetta (Geschossmagazin):
Eine Beleuchtungsöffnung:
Ein Waschbecken im Hauptkorridor:
Der Generatorenraum der Panzerbatterie:
Verlässt man die Batterie durch den westlichen Zugang, erreicht man das südliche Kavernenmagazin:
Ein Pendant dazu gibt es auch im nördlichen Teil der Festung. Wie schon gesagt: Alles offen und frei zugänglich!
Von allen Festungsanlagen rund um Udine ist die Forte di Osoppo sicherlich eine der eindrucksvollsten, nicht zuletzt, weil alle noch vorhandenen Elemente frei besichtigt werden können.
Bereits in vorgeschichtlicher Zeit war der Felsen besiedelt, und schon in vorrömischer und erst recht in römischer Zeit stellte er eine wichtige strategische Position dar, weil in seiner Nähe wichtige Straßen und eine Furt durch den Tagliamento verliefen.
Die Besiedlung setzte sich nachweislich bis ins Mittelalter fort; eine Belagerung durch die Avaren im Jahr 610 ist sogar schriftlich festgehalten.
902 zerstörten die Ungarn die befestigte Siedlung; im Nachgang wurde eine Burg errichtet, von der es jedoch überwiegend schriftliche Erwähnungen gibt und weniger Funde.
Nach einer Belagerung im Jahr 1514 wurde das Castel Novo erbaut, das eine deutlich reduzierte Verteidigungsfunktion hatte und eher Wohnzwecken diente. Reste des Untergeschosses sind heute noch zu sehen.
Zu Zeiten Napoleons wurde die Festung von den Franzosen erobert und spielte eine Rolle in den Auseinandersetzungen zwischen Habsburg und Frankreich um die Vorherrschaft über das Friaul.
Im Rahmen des Risorgimentos (eine Bestrebung, die unabhängigen Fürstentümer und Regionen der Apenninen-Halbinsel zu einem Nationalstaat Italien zu vereinigen) gelang es den Friulanern im März 1848, die kaiserlichen Truppen aus der Festung zu vertreiben und sie für fast 7 Monate besetzt zu halten. Nachdem die Gegend an Italien gefallen war, wurden konstruktive Änderungen an der Festung durchgeführt, vor allem nachdem sie im Jahr 1900 in das Verteidigungssystem Alto Tagliamento – Val Fella integriert wurde.
Im ersten Weltkrieg war die Festung in keine Kampfhandlungen involviert und diente als Garnison; danach wurde sie erneut umgestaltet. Im zweiten Weltkrieg besetzten deutsche Truppen das Fort, was zahlreiche und intensive Bombardements durch die Alliierten nach sich zog, die zu vielen Zerstörungen führten.
Einen erneuten Schlag erfuhr die Festung durch das Erdbeben von 1976, das u.a. die Kirche San Pietro beschädigte.
Bereits zwischen den Weltkriegen, im Jahr 1923, war die Festung zum Nationaldenkmal erklärt worden, und 1951 wurde sie endgültig demilitarisiert.
Heute kann sie problemlos besichtigt werden; im Gegensatz zu anderen Festungsanlagen rund um Udine konnten wir bei unserem Besuch im Juni 2019 keine Einschränkungen wie z.B. verschlossene Räume oder Gebäude feststellen.
Leider gab es aber Einschränkungen anderer Art: Zum einen hielt uns die enorme Hitze davon ab, die von dichter Vegetation überwucherten Teile der Festung näher zu erkunden (vor allem den Nordteil), zum anderen verhinderte die Anwesenheit des italienischen Militärs, das offenbar in der Nähe der Panzerbatterie eine Übung durchführte, so manche interessante Aufnahme.
Der einzige Plan, der uns zur Orientierung zur Verfügung stand, ist dieser hier:
Im Großen und Ganzen genügte er, um sich zurecht zu finden, zumal viele Elemente des Forts gut beschildert sind. Einzelne darauf sichtbare Elemente wie z.B. die „Batterie Nr. 1“ konnten wir jedoch nicht entdecken.
Das erste, was man von der Forte di Osoppo sieht, wenn man der Via Divisione Julia folgt (der Weg zur Festung ist vom Ortskern aus gut ausgeschildert), ist das Eingangstor:
Ma kann mit dem Auto durchfahren bis zum Vorplatz der Kirche San Pietro und das Auto dort abstellen:
Am Nordostrand des Platzes fallen sofort umfangreiche Gebäuderuinen auf:
Es handelt sich um die Überreste des Offizierskasinos; die nachfolgende Aufnahme (Aufnahmedatum unbekannt) zeigt es in intaktem Zustand:
Die Aussicht vom östlichen Rand des Platzes ist atemberaubend. Ein interessantes Detail im Tal ist der Parco del Rivellino – man erkennt deutlich die Reste der Bastionen aus napoleonischer Zeit:
Ein weiteres Bauwerk auf dem Platz ist die „Casa del Tamburo“, dessen Ursprünge auf die Zeit zurückgehen, als das Friaul venezianisch war. Das Gebäude diente im Lauf der Zeit unterschiedlichen Zwecken, als Unterkunft des Kommandanten Mitte des 18 Jahrhunderts bis zur Nutzung als Magazin und Krankenstation im frühen 20. Jahrhundert. Heute beherbergt das Gebäude eine Bar:
Folgt man dem an der Westseite der Casa del Tamburo verlaufenden Weg nach Süden, passiert man die ehemaligen Unterkunftsgebäude (auf dem Foto rechts zu sehen):
Man gelangt schließlich zum Reduit aus venezianischer Zeit:
Am Ende des Reduits führt eine Treppe hinunter zur Panzerbatterie. Sie wurde 1909 – 1910 errichte und war mit 4 Geschützen 149/A unter drehbaren Panzerkuppeln ausgestattet. In der jüngeren Vergangenheit hat man das Batteriedach neu betoniert, dabei aber – im Gegensatz zu den meisten anderen Panzerbatterien – die Geschützbrunnen nicht verfüllt:
Hier ein Blick aus der Panzerbatterie nach außen in Richtung Reduit:
Der zentrale Korridor der Panzerbatterie; die Zugänge zu den Geschützbrunnen sind auf der linken Seite.
Einer der Geschützbrunnen:
Eine Riservetta (Geschossmagazin):
Eine Beleuchtungsöffnung:
Ein Waschbecken im Hauptkorridor:
Der Generatorenraum der Panzerbatterie:
Verlässt man die Batterie durch den westlichen Zugang, erreicht man das südliche Kavernenmagazin:
Ein Pendant dazu gibt es auch im nördlichen Teil der Festung. Wie schon gesagt: Alles offen und frei zugänglich!
Von allen Festungsanlagen rund um Udine ist die Forte di Osoppo sicherlich eine der eindrucksvollsten, nicht zuletzt, weil alle noch vorhandenen Elemente frei besichtigt werden können.